Erzählweisen
Die drei Arten des Erzählens
Erzähler: Der Begriff meint zumeist den Autor in seiner Rolle als Verfasser eines erzählenden Textes. Als Erzähler bezeichnet man aber auch die in jedem erzählenden Text sozusagen abstrakt vorhandene Instanz, aus deren Perspektive die Handlung und die Personen gesehen werden und aus deren Sichtweise die Geschichte erzählt und so dem Leser vermittelt wird. Das Vorhandensein einer solchen Mittler-Instanz ist das Hauptmerkmal der erzählenden Gattungen – im Gegensatz etwa zum Drama oder zur Lyrik, wo es keine solche Instanz gibt, sondern wo das lyrische Ich seine Empfindungen vor dem Leser präsentiert bzw. die jeweils sprechende Figur den anderen Figuren und damit dem Zuschauer bzw. Leser ihre eigene Perspektive unvermittelt vorführt.
Ich-Erzähler: Eine vom Autor erfundene Person oder Figur, die als erzählendes Ich meist zurückliegende eigene Erlebnisse berichtet und damit als jetzt Erzählender und einstige Hauptperson zugleich auftritt. Neben dem traditionellen Ich-Erzähler, der zurückliegende Ereignisse berichtet – und entsprechend überwiegend in der Vergangenheit spricht (episches Präteritum), findet man in der neueren Literatur auch häufig den Typ des gleichsam noch mitten in der Handlung stehenden und erlebenden, d.h. nicht rückblickenden berichtenden und reflektierenden Ichs. Er schreibt daher meistens in der Gegenwartsform (Präsens).
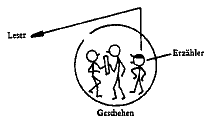
Auktoriale Erzählsituation: Der Erzähler ist beim Erzählen der Geschichte seiner Personen oder Figuren allwissend und mehr oder weniger deutlich wertend im Hintergrund präsent, tritt mitunter sogar mit kommentierenden Bemerkungen, mit Vorankündigungen späterer Ereignisse oder mit kleinen Anreden an den Leser in den Vordergrund. Man nennt ihn auch den olympischen Erzähler, da er wie ein griechischer Gott auf dem Olymp alles überblickt.
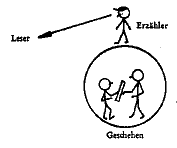
Personale Erzählsituation: Der Erzähler bleibt quasi unsichtbar, die Geschehnisse werden aus der Perspektive der jeweils handelnden oder denkenden Personen berichtet. Sehr viele Texte bieten ein Gemisch aus auktorialen und personalen Erzählsituationen, wobei im traditionellen Roman die auktoriale Erzählsituation dominiert, im sog. modernen Roman oft die personale.
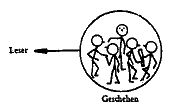
Erzählweisen: Textvorlage
Inhalt
Die Scheidungswaise Jo sieht ihre Mutter nach zwölf Jahren zum ersten Mal wieder. Doch die Annäherung erweist sich als schwierig, ihre Hoffnung auf Freundschaft und Nähe wird bitter enttäuscht. Desillusioniert von den Lebenslügen der Erwachsenen vollzieht Jo die Trennung. Wie eine Schlangenhaut wirft sie ihre Kindheit ab.
Aufgaben:
1. Fassen Sie den Inhalt des Romanauszuges knapp zusammen.
2.1 Charakterisieren Sie die Ich-Erzählerin in Form einer tabellarischen Übersicht.
2.2 Erstellen Sie eine komplette Charakterisierung der Ich-Erzählerin.
Das Blütenstaubzimmer
von Zoë Jenny
Als meine Mutter ein paar Straßen weiter in eine andere Wohnung zog, blieb ich bei Vater. Das Haus, in dem wir wohnten, roch nach feuchtem Stein. In der Waschküche stand eine Druckmaschine, auf der mein Vater tagsüber Bücher druckte. Immer, wenn ich vom Kindergarten nach Hause kam, ging ich zu ihm in die Waschküche, und wir stiegen gemeinsam in die Wohnung hinauf, wo wir unser Mittagessen kochten. Abends vor dem Einschlafen stand er neben meinem Bett und zeichnete mit einer glühenden Zigarette Figuren ins Dunkel. Nachdem er mir heiße Milch mit Honig gebracht hatte, setzte er sich an den Tisch und begann zu schreiben. Im rhythmischen Gemurmel der Schreibmaschine schlief ich ein, und wenn ich aufwachte, konnte ich durch die geöffnete Tür seinen Hinterkopf sehen, ein heller Kranz von Haaren im Licht der Taschenlampe, und die unzähligen Zigarettenstummel, die, einer neben dem anderen, wie kleine Soldaten den Tischrand säumten.
Da die Bücher, die mein Vater verlegte, nicht gekauft wurden, nahm er eine Stelle als Nachtfahrer an, damit er tagsüber weiterhin die Bücher drucken konnte, die sich erst im Keller und auf dem Dachboden und später überall in der Wohnung stapelten.
Nachts fiel ich in einen unruhigen Schlaf, in dem die Träume zerstückelt an mir vorbeischwammen wie Papierschnipsel in einem reißenden Fluss. Dann das klirrende Geräusch, und ich war hellwach. Ich blickte an die Decke zu den Spinnengeweben empor und wusste, dass mein Vater jetzt in der Küche stand und den Wasserkessel auf den Herd gesetzt hatte. Sobald das Wasser kochte, ertönte ein kurzes Pfeifen aus der Küche, und ich hörte, wie Vater den Kessel hastig vom Herd nahm. Noch während das Wasser tropfenweise durch den Filter in die Thermoskanne sickerte, zog der Geruch von Kaffee durch die Zimmer. Darauf folgten rasch gedämpfte Geräusche, ein kurzer Moment der Stille; mein Atem begann schneller zu werden und ein Kloß formte sich in meinem Hals, der seine volle Größe erreicht hatte, wenn ich vom Bett aus sah, wie Vater, in seine Lederjacke gehüllt, leise die Wohnungstür hinter sich zuzog. Ein kaum hörbares Klack, ich wühlte mich aus der Bettdecke und stürzte ans Fenster. Langsam zählte ich eins, zwei, drei; bei sieben sah ich, wie er mit schnellen Schritten die Straße entlangging, eingetaucht in das dumpfe Gelb der Straßenlaterne; bei zehn war er stets beim Restaurant an der Ecke angelangt, wo er abbog. Nach weiteren Sekunden, in denen ich den Atem anhielt, hörte ich den Motor des Lieferwagens, der laut ansprang, sich entfernend immer leiser wurde und schließlich ganz verstummte. Dann lauschte ich in die Dunkelheit, die langsam, ein ausgehungertes Tier, aus allen Ecken kroch. In der Küche knipste ich das Licht an, setzte mich an den Tisch und umklammerte die noch warme Kaffeetasse. Suchte den Rand nach den braunen, eingetrockneten Flecken ab, das letzte Lebenszeichen, wenn er nicht mehr zurückkehrte. Allmählich erkaltete die Tasse in meinen Händen, unaufhaltsam drang die Nacht herein und breitete sich in der Wohnung aus. Sorgfältig stellte ich die Tasse hin und ging durch den schmalen hohen Gang in mein Zimmer zurück.
Vor dem Fensterrechteck, aus dem ich zuvor meinen Vater beobachtet hatte, hockte jetzt das Insekt, das mich böse anglotzte. Ich setzte mich auf die äußerste Kante des Bettes und ließ es nicht aus den Augen. Jederzeit konnte es mir ins Gesicht springen und seine knotigen, pulsierenden Beine um meinen Körper schlingen. In der Mitte des Zimmers tobten Fliegen um die Glühbirne. Ich starrte in das Licht und auf die Fliegen, und aus den Augenwinkeln beobachtete ich das Insekt, das schwarz und regungslos vor dem Fenster kauerte.
Nach und nach wickelte mich Müdigkeit ein wie warmes Fell. Ich strengte mich an, zwischen den nur noch halb geöffneten Augenlidern die einzelnen Fliegen zu unterscheiden, doch sie schlossen sich mehr und mehr zu einem in der Luft schwirrenden Kreis. Das Insekt kicherte und ich spürte seine Fühler langsam über den Boden auf meine vom Bett hängenden Füße zukriechen. Ich rannte in die Küche und hielt den Kopf unter das kalte Wasser. Meine Blase war angeschwollen und schmerzte. Ich traute mich nicht, auf die Toilette zu gehen, die auf dem Zwischenstock lag, weil das Licht im Treppenhaus nach kurzer Zeit ausging. Ich spürte das Insekt, das sich in meinem Zimmer regte und nur darauf wartete, mich im dunklen Treppenhaus zu überfallen. In der Küche auf und ab gehend, begann ich die Lieder vor mich hin zu summen, die wir im Kindergarten gelernt hatten. Nur wenige Lieder konnte ich auswendig, weshalb ich sie immer wieder anders zusammensetzte. Mit dem Anschwellen des Schmerzes in der Blase wurde auch meine Stimme lauter, von der ich inständig hoffte, sie trüge mich aus meinem Körper hinaus. Schließlich blieb ich vor dem Küchenschrank stehen und pinkelte in ein Gefäß, das ich zwischen die Beine klemmte. Sobald das Morgenlicht durch das Küchenfenster schimmerte, zog sich das Insekt in seine ferne Welt zurück. Die Dunkelheit wurde langsam verschluckt. Erschöpft ging ich in mein Zimmer zurück und wühlte mich in die Bettdecke. Um sieben Uhr läutete das Telefon. Es war Vater, der mich von unterwegs anrief, um mich zu wecken.
Die Sonntage verbrachte ich bei meiner Mutter. Abends stand sie mit aufgestecktem Haar vor dem großen Spiegel und fuhrwerkte mit Stiften und Schwämmchen in ihrem Gesicht herum. Ich reichte ihr die Döschen und Fläschchen, die auf dem Fensterbrett standen und schraubte die wertvoll aussehenden Blumen und tropfenförmigen Verschlüsse von den Parfümflaschen. Sobald der Babysitter kam, löste sie ihr Haar, das sich braun und duftend über ihrem Rücken auffächerte, und verschwand in die Nacht hinaus. Später weckte mich ihr Wimmern aus dem Schlaf, und ich tastete mich im Dunkeln zu ihrem Bett. Sie lag unter der farbigen Blumendecke, geschüttelt von mir unbegreiflichen geheimnisvollen Schmerzen. Von ihrem Gesicht sah ich nur ein Dreieck aus Nasenspitze und Mund, der Rest lag unter ihren weißen Händen begraben. Nach einer Weile schlug sie die Decke zurück, und ich kroch hinein in das salzigwarme Bett.
Einmal in der Woche holte sie mich mittags von der Schule ab. Von weitem sah ich sie neben dem Eisentor stehen, und ich rannte über den Schulhof auf sie zu. Sie nahm mich an der Hand und wir gingen zusammen in die Stadt. In den Umkleidekabinen, die nach Schweiß und Plastik rochen, packte sie einige Kleider in die große Schultertasche, die anderen legte sie wieder in die Regale zurück. Sobald sie an der Kasse ein Paar Socken oder ein T-Shirt bezahlt hatte, streichelte sie meinen Kopf, wie man frischgeborene Kätzchen streichelt, und die Verkäuferinnen, die uns durchs Schaufenster nachschauten, klatschten entzückt in die Hände. Das waren Tage, an denen es haufenweise Schokoladenkuchen gab und das Gesicht meiner Mutter weich und fröhlich war. Im Restaurant, während ich aus einem Trinkhalm meinen Sirup schlürfte, griff meine Mutter immer wieder in die Tasche, nach dem Stoff, ihr Mund stand leicht offen, und die Augen waren riesengroß, als sei es kaum zu ertragen, und ich wusste, sie war glücklich. Zu Hause entfernte sie mit der Schere die Preisetiketten von den Kleidern, hängte sie sorgfältig an den Kleiderständer und rollte ihn langsam mit dem erhobenen Kopf einer Königin, die vor ihr Reich tritt, ins Zimmer.
Immer wieder wartete ich nach Schulschluss stundenlang vor dem Eisentor auf sie. Aber sie kam nicht mehr. Ich fragte Vater, ob mit ihr etwas geschehen sei, aber er schüttelte den Kopf und schwieg.
Doch nach einigen Wochen stand sie wieder da, küsste mich aufs Haar und hieß mich ins Auto steigen. Diesmal fuhren wir nicht in die Stadt, und ich freute mich. Sie parkte an einem Waldweg. Ich übersprang die Lücken zwischen den Zacken, die die Räder eines Traktors in die von der Hitze brüchige Erde gestoßen hatten. Das helle Kleid meiner Mutter bauschte sich wolkig um ihren Körper, und ich ahnte, dass sie gleich etwas Wichtiges sagen würde. Aber sie schwieg den ganzen Weg, bis die Spuren des Traktors immer undeutlicher wurden und wir auf einer Wiese standen. Meine Mutter legte sich hin, ich legte mich neben sie auf die trockene Erde und spürte neben mir ihren glatten, pochenden Hals. Sie sagte, dass sie einen Mann, Alois, getroffen habe, den sie liebe, so wie sie einmal meinen Vater geliebt habe, und dass sie mit ihm fortgehen werde, für immer. Überall, wo ich hinsah, waren diese gelben und roten Blütenköpfe, die einen Duft ausströmten, der mich schwindlig und müde machte. Ich drehte mich zur Seite, das Ohr auf den Boden gepresst, hörte ich ein Summen und Knistern, als bewege sich da etwas tief unter der Erde, während ich ihren weit entfernten Mund weiterreden sah und ihre Augen, die in den Himmel schauten, der wie eine greifbare blaue Scheibe über uns schwebte.
Zoë Jenny, Das Blütenstaubzimmer, Frankfurt 1999
